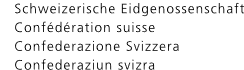Innovationsräume VBS – von der Theorie in die Praxis
Bereits kurz nach der Beauftragung der Innovationsräume VBS durch die Departementschefin, Viola Amherd, wurden mehrere Pilotprojekte durchgeführt. Dabei konnten schon erste Erfolge, basierend auf den definierten Zielen der Innovationsräume VBS, erreicht werden. In diesem Beitrag möchten wir Dir die Vorhaben und den Weg, den sie zurückgelegt haben, näherbringen.
Anela Ziko, Fachbereich Innovation und Prozesse, Kompetenzbereich Wissenschaft und Technologie

Die Wahl des geeigneten Innovationsraums orientiert sich an verschiedenen Kriterien. Sie ist abhängig von der Herausforderung, dem Lösungsreifegrad der verfügbaren Lösungen sowie der angestrebten Lösung. Dabei nimmt der Bedarfsträger eine zentrale Rolle ein und ist von Anfang bis Ende in den gesamten Prozess eingebunden, inklusive Verwertung und Verbreitung der Ergebnisse. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Herausforderung richtig verstanden, eine bedarfsgerechte Lösung entwickelt und die Erkenntnisse nachhaltig in die Organisation des Bedarfsträgers einfliessen.
Wir haben in den letzten beiden Beiträgen der Insights-Serie zum Thema «Innovation» die Entstehungsgeschichte der Innovationsräume VBS sowie deren Umsetzung kennengelernt. Dabei handelt es sich bei diesen Räumen nicht um physische Räume, sondern um Verfahren, um Lösungen für identifizierte Herausforderungen des VBS zu finden. Welcher Innovationsraum verwendet wird, hängt jeweils davon ab, inwiefern eine Lösung zur Bedarfsdeckung bekannt und die Bedarfsdeckung bestätigt ist. Aufgrund des sehr unterschiedlichen Reifegrades von Lösungen und den damit verbundenen Unsicherheiten, kann eine erfolgreiche Verwertung unterschiedliche Formen annehmen. Dies kann zum einen bedeuten, dass eine über einen Innovationsraum identifizierte Lösung in eine Beschaffung überführt werden kann, oder aber auch, dass mit heutigen Technologien und Lösungen der Bedarf noch nicht gedeckt werden kann. In diesem Fall ist es von zentraler Bedeutung, dass diese Erkenntnisse verbreitet und zum Beispiel die noch fehlenden Technologieentwicklungen verfolgt oder ein spezifisches Forschungsprojekt lanciert werden. Ein wichtiger Aspekt des Erfolges ist, dass die gewonnenen Erkenntnisse stets in die Weiterentwicklung einfliessen – sei dies in Form einer Beschaffung, der weiteren Beobachtung der Entwicklungen der Technologie auf dem (Welt-)Markt oder auch Anpassung der Planungsgrundlagen.
Zeitsynchronisation im Führungsnetz
Mit einer zunehmenden Zahl von verteilten Sensoren und deren Vernetzung gewinnt auch die Verfügbarkeit einer sicheren und genauen Zeitbasis an Wichtigkeit. Doch was heisst eigentlich «genau»? Im Alltag kann eine kleine Zeitabweichung unbemerkt bleiben, bei komplexen Sensorsystemen jedoch einer Ewigkeit gleichkommen. Für eine möglichst genaue Zeitsynchronisation testete armasuisse Wissenschaft und Technologie (W+T) eine Lösung: White Rabbit. Diese soll eine robustere, genauere und unabhängige Synchronisation ermöglichen als dies mit anderen Methoden möglich ist. Heute wird dazu in vielen Fällen auf Zeitsignale von Satellitennavigationssysteme wie beispielsweise das Global Positioning System GPS zurückgegriffen. Bei diesen Systemen wird die Zeit zusammen mit dem Ort bestimmt. Dadurch hat ein GPS-Empfänger eine immer auf wenige milliardstel Sekunden genaue Zeit und kann diese weiteren Systeme zur Verfügung stellen. Bekannterweise sind solche Systeme jedoch sehr anfällig auf Funkstörungen und stellen eine grosse Abhängigkeit von Betreibern dieser Satellitennavigationssysteme dar.
Die ersten Tests hat armasuisse W+T mit der Hochschule für Technik und Architektur in Freiburg durchgeführt. In einem Laboraufbau wurde eine Netztopologie aufgebaut, wie sie in einem typischen, schweizweiten Einsatz mit mehreren Knoten vorkommen würde. So konnten Komponenten einzeln ausgetauscht und deren Einfluss auf die Genauigkeit getestet werden. Im Anschluss an diese Untersuchungen wurde mit den Forschenden vom Eidgenössischen Institut für Metrologie METAS und dem Universitätsnetzbetreiber Switch kooperiert. Gemeinsam wurde an einem Versuchsaufbau innerhalb des Switch-Netzes gearbeitet. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen nun für die Implementation von White Rabbit im Führungsnetz Schweiz verwertet werden, damit die Sensorsysteme der Armee in Zukunft auf eine sichere und unabhängige Zeitbasis zurückgreifen können. Da hier auf einer bestehenden Lösung aufgebaut werden konnte und es darum ging die Eignung zu überprüfen, handelte es sich in diesem Fall um den Innovationsraum «Test Run».
Akustische Analyse von ballistischen Schutzplatten
Ballistische Schutzplatten stellen ein wichtiges Element für den Personenschutz der Schweizer Armee dar. Dabei handelt es sich für die höchsten Schutzklassen von Keramikplatten, welche durch äussere Einflüsse, zusätzlich zu tatsächlichen ballistischen Einwirkungen wie zum Beispiel der Handhabung, Einbussen in der eigentlichen Schutzwirkung erfahren können. Bereits durch ein Fallenlassen können Brüche entstehen, welche selbst dann, wenn der Defekt mit blossem Auge unsichtbar ist, den ballistischen Schutz aber erheblich verringern. Um die Sicherheit der Angehörigen der Armee sicherzustellen, ist es wichtig, über ein Testverfahren zu verfügen, mit dem sich der Zustand der Schutzplatten zuverlässig und schnell beurteilen lässt.
Der Zustand der keramischen Schutzplatten wird in der Regel anhand von Röntgenaufnahmen beurteilt: Beschädigungen an der Platte, wie beispielsweise Risse, erscheinen kontrastreich auf dem Röntgenbild, während sie bei der Betrachtung mit blossem Auge oft unsichtbar bleiben. Und je nach Ausrichtung, Position und Grösse ist ein Bruch auf dem Röntgenbild schwer zu erkennen. Aus diesen Gründen braucht es eine alternative Inspektionsmethode. Basierend auf einem Projekt innerhalb der Ressortforschung ist bei armasuisse W+T dabei ein neuartiges Verfahren entwickelt worden, um die Güte von Schutzplatten zu überprüfen. Gemeinsam mit der Ingenieurschule Haute Ecole Arc in Le Locle untersuchte armasuisse W+T ein akustisches Verfahren, welches den Prozess der Prüfung von Keramikschutzplatten vereinfachen und beschleunigen soll. Das Prinzip beruht darauf, die Platte in Schwingung zu versetzen. Die induzierten Vibrationen stehen in Beziehung zu den inneren Kräften in der Platte. Defekte wie Risse ändern diese, was sich akustisch detektieren lässt. Die Analyse der akustischen Signale erlaubt also eine schnelle Erkennung von defekten Schutzplatten, da diese in den meisten Fällen die akustische Signatur einer Schutzplatte ändern. Die Empfindlichkeit der Methode soll jedoch noch genauer untersucht werden. Nachdem im Rahmen eines Forschungsauftrages ein Demonstrator entwickelt wurde, ging es darum, die Eignung im operativen Umfeld des Bedarfsträgers zu untersuchen. In diesem Zusammenhang wurden weitere Demonstratoren beschafft und der Logistikbasis der Armee (LBA) zu Testzwecken, im Rahmen eines «Test Runs», überlassen.
Basierend auf den gesammelten Erkenntnissen wurde nun die Verwertung in Form eines Beschaffungsprojektes angestossen. Es ist das erste Innovationsprojekt, welches nun in eine Beschaffung überführt wurde.
Auf externen Kompetenzen aufbauen: Sandbox Seriennummer
Das Armeelogistikcenter Thun (ALC-H) ist zuständig für die schweizweite Einlagerung der persönlichen Waffen. Vor dem Einlagern werden die drei Seriennummern auf jeder Waffe manuell kontrolliert und erfasst. Diese Arbeit ist sehr monoton und ermüdend. Der Bedarf, mit dem die LBA auf armasuisse W+T zugkommen ist, ist das menschliche Ablesen, Kontrollieren und Erfassen der Seriennummern auf den Waffen zu automatisieren. Aufgrund der Tatsache, dass das effiziente und automatisierte Erfassen von Nummern unterschiedlichster Art in anderen Industriezweigen ein wichtiger Bestandteil der Prozessoptimierung darstellt, bietet sich die Fragestellung als Transferinnovation an. Das Ziel der Sandbox ist es somit, technologieoffen bestehende, und in anderen Industriezweigen bereits etablierte Lösungsansätze, zu erproben. Dabei stehen keine Produkte im Vordergrund, sondern die Technologien und Lösungsansätze, welche sich im Einsatz befinden. Die Herausforderung besteht darin, dass die Seriennummern im Metall eingraviert sind und unterschiedliche Abnutzungserscheinungen sowie einen unterschiedlichen Fettgehalt aufweisen. Dafür soll im Rahmen einer Sandbox eine geeignete Lösung für den Bedarf gefunden werden. Die Lösungsanbieter, das heisst die Industrie, wird mittels einer öffentlichen Ausschreibung auf simap zur Teilnahme eingeladen. Die Selektion der tatsächlichen Teilnehmer erfolgt dabei mittels vordefinierten und in den Ausschreibungsunterlagen enthaltenen Bewertungskriterien. Während der Sandbox werden anschliessend die Lösungen im tatsächlichen Umfeld mit repräsentativen Tests bezüglich deren Eignung untersucht und beurteilt. Dabei geht es darum, Technologien und nicht Produkte zu analysieren und Lösungsansätze zu identifizieren. Mit Abschluss der Sandbox wird den Teilnehmern jeweils ein Beobachtungsbericht zur Verfügung gestellt und die interne Verwertung der Erkenntnisse eingeleitet.
Diese aktuellen Beispiele sollen illustrieren, wie die Innovationsräume zur Lösungsfindung genutzt werden können. Sie verdeutlichen, dass «erfolgreich» vieles bedeuten kann: von einem Erkenntnisgewinn bis hin zur Umsetzung der gewonnenen Lösung im Rahmen einer Beschaffung.
Wie armasuisse W+T sich im Bereich Innovation international vernetzt und wo es Herausforderungen, aber auch Chancen für den Standort Schweiz gibt, erfährst Du im nächsten Beitrag.